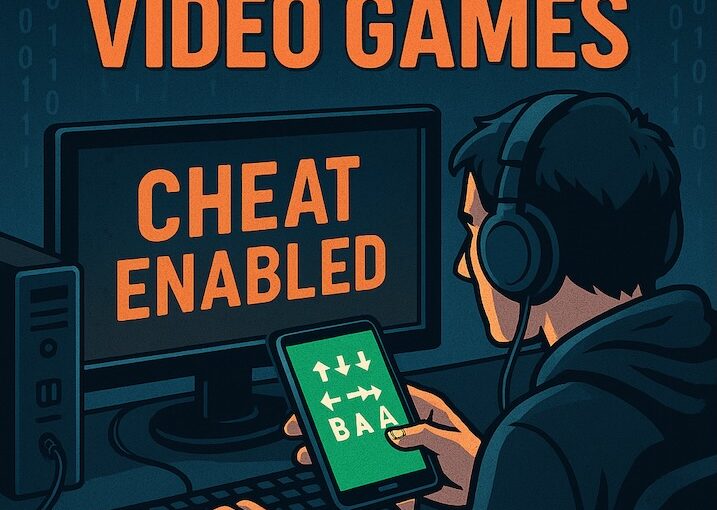In einer vielbeachteten Entscheidung vom 31. Juli 2025 (BGH, Urt. v. 31.07.2025 – I ZR 157/21 – Action Replay II) hat der Bundesgerichtshof (nochmals) die urheberrechtliche Reichweite des Schutzes von Computerprogrammen präzisiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die Modifikation von Arbeitsspeicherinhalten durch Drittsoftware – ohne Veränderung des Quell- oder Objektcodes – eine unzulässige Umarbeitung im Sinne des § 69c Nr. 2 UrhG darstellt. Der BGH verneinte dies und folgte damit der Vorabentscheidung des EuGH.
Sachverhalt
Die Klägerin, Lizenznehmerin der bekannten Spielekonsole PSP, hatte die Beklagten auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz in Anspruch genommen. Hintergrund waren zwei von den Beklagten vertriebene Softwareprodukte („Action Replay PSP“ und „TiltFX“), mit denen Nutzer während des Spielbetriebs auf den Programmablauf ihrer PSP-Spiele Einfluss nehmen konnten – etwa durch Freischalten zusätzlicher Spielfiguren oder durch das Entsperren von Spielinhalten ohne vorherige Leistungserbringung. Technisch wurde dies dadurch erreicht, dass die Beklagten-Software auf vom Spiel erzeugte Variablen im RAM zugriff und deren Werte veränderte, ohne jedoch den Spielcode selbst oder dessen gespeicherte Vervielfältigungen zu modifizieren.
Die Klägerin sah darin eine unzulässige Umarbeitung ihrer urheberrechtlich geschützten Spiele. Nachdem LG und OLG Hamburg der Klage teilweise stattgegeben bzw. sie abgewiesen hatten, setzte der BGH das Verfahren aus und legte die zentrale Rechtsfrage dem EuGH zur Auslegung der Software-Richtlinie 2009/24/EG vor.
Juristische Analyse
I. Schutzgegenstand des Urheberrechts bei Computerprogrammen
Zentral für die Entscheidung war die dogmatische Abgrenzung zwischen dem geschützten Bereich eines Computerprogramms und bloßer Nutzung seiner Funktionalitäten. § 69a Abs. 1 und 2 UrhG schützt alle Ausdrucksformen eines Programms, nicht jedoch die zugrunde liegenden Ideen und Prinzipien oder die bloße Funktionalität.
Der EuGH stellte in seiner Vorabentscheidung klar: Der urheberrechtliche Schutz umfasst Quell- und Objektcode sowie Ausdrucksformen, die eine Vervielfältigung oder Reproduktion des Programms ermöglichen. Nicht umfasst sind hingegen bloße Dateninhalte im RAM, die vom Programm angelegt und verwendet, aber nicht zur Reproduktion des Codes genutzt werden können.
II. Keine Umarbeitung i.S.d. § 69c Nr. 2 UrhG
Der BGH greift diese Differenzierung auf und stellt klar: Die streitgegenständliche Drittsoftware greift nicht in den Quell- oder Objektcode der Spiele ein, sondern wirkt ausschließlich auf vom Programm erzeugte, flüchtige Arbeitsspeicherdaten ein – etwa Zahlenwerte für Energie, Geschwindigkeit oder Freischaltungen. Diese Manipulation verändert weder Struktur noch Ablauflogik des Programms selbst. Entscheidend sei, dass die Spiele weiterhin wie programmiert ablaufen; die durch die Drittsoftware veränderten Werte könnten auch durch reguläres Gameplay erreicht werden.
Der BGH lehnt eine funktionalistische Betrachtung ab, wonach schon die Änderung des Ablaufverhaltens – unabhängig vom Eingriff in den Code – als Umarbeitung qualifiziert werden könne. Der urheberrechtliche Schutz erfasse gerade nicht den „programmgemäßen Ablauf“ an sich, sondern nur dessen technische Ausdrucksformen.
III. Keine Wettbewerbsverletzung oder deliktische Haftung
Auch die hilfsweise geltend gemachten Ansprüche wegen gezielter Mitbewerberbehinderung (§ 4 Nr. 10 UWG a.F. / § 4 Nr. 4 UWG) oder Eingriffs in den eingerichteten und ausgeübten Gewerbebetrieb blieben erfolglos. Das OLG hatte insoweit eine unlautere Behinderung ebenso wie eine betriebsbezogene Schädigung verneint, ohne dass diese Bewertung vom BGH beanstandet wurde.
Ein Hilfsantrag, gerichtet auf das Verbot der Umgehung technischer Schutzmaßnahmen, scheiterte daran, dass die Klägerin keine ausreichenden Darlegungen dazu vorgebracht hatte, inwieweit die beanstandeten Produkte Kopierschutzmechanismen ihrer Software tatsächlich umgingen oder das Rechtemanagement beeinträchtigten.

Diese Kernaussage schafft erhebliche Rechtssicherheit für Anbieter von ergänzender Software im Gaming- und Emulatorbereich, markiert aber zugleich die Grenze des urheberrechtlichen Schutzes von Spielesoftware. Wer Spiele manipuliert, verletzt unter Umständen Spielregeln – aber nicht zwingend das Urheberrecht.
Schlussfolgerung
Die Entscheidung des BGH konkretisiert in klarer Abgrenzung die im Einzelfall zu bewertende Linie zwischen urheberrechtlich geschütztem Programmcode und nicht geschützten Nutzungsvarianten im Arbeitsspeicher. Die Bilanz: Solange Drittsoftware nicht in die Struktur eines Programms eingreift, sondern nur flüchtige Werte manipuliert, liegt keine Umarbeitung im Sinne des Urheberrechts vor.
- Veränderungssperren bei Software-Besichtigungen - Oktober 6, 2025
- Cybersecurity in der Software-Lieferkette - September 24, 2025
- Software Bill of Materials (SBOM) - September 14, 2025