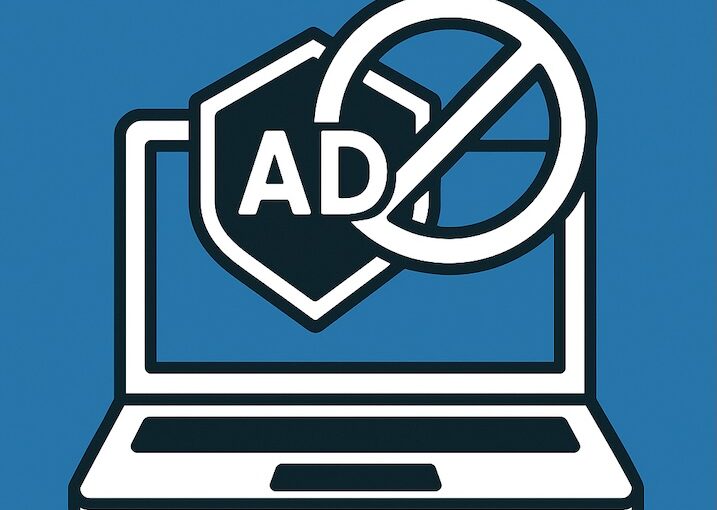Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung „Werbeblocker IV“ (I ZR 131/23) die urheberrechtlichen Implikationen von Werbeblocker-Software weiter präzisiert. Im Zentrum steht die Frage, ob ein Werbeblocker, der in die Darstellung von Webseiten eingreift, eine unzulässige Umarbeitung oder Vervielfältigung eines geschützten Computerprogramms im Sinne des § 69c Nr. 1 und 2 UrhG darstellt.
Der BGH kritisiert die Vorinstanz für eine unzureichende Klärung des Schutzgegenstands und verweist die Sache zurück. Die Entscheidung enthält wichtige Hinweise zur Abgrenzung zwischen zulässiger Beeinflussung des Programmablaufs und Eingriffen in die geschützte Substanz eines Programms.
Sachverhalt
Die Klägerin, ein Verlagshaus mit verschiedenen Online-Portalen, sah durch den Einsatz des Werbeblockers „AdBlock Plus“ ihre Urheberrechte verletzt. Dieser bewirkt, dass beim Aufruf der Webseiten Werbeinhalte entweder gar nicht vom Server abgerufen oder im Browser nicht angezeigt werden. Der Klägerin zufolge handle es sich bei der Gesamtstruktur ihrer Webseiten – bestehend aus HTML-, JavaScript- und CSS-Code – um urheberrechtlich geschützte Computerprogramme. Der Werbeblocker greife durch Blockieren oder Überschreiben von Programmteilen in diese Programmstruktur ein und verändere sie, insbesondere durch Manipulation der im Browser erzeugten Datenstrukturen (DOM-Knotenbaum, CSSOM, Render Tree).
Die Klage auf Unterlassung, Auskunft und Schadensersatz wurde in den Vorinstanzen abgewiesen. Das Berufungsgericht hielt eine Umarbeitung im Sinne von § 69c UrhG für nicht gegeben, weil es sich lediglich um Eingriffe in den Programmablauf, nicht aber in die Programmsubstanz handele.
Juristische Analyse
1. Maßstab für Umarbeitung und Vervielfältigung nach § 69c UrhG
Der BGH weist zunächst auf den unionsrechtlich geprägten Schutzrahmen für Computerprogramme hin: Geschützt sind gemäß Art. 1 und 4 der Richtlinie 2009/24/EG sowie § 69a, § 69c UrhG nur Ausdrucksformen eines Programms – insbesondere Quell- und Objektcode –, nicht aber bloße Funktionalitäten oder Nutzerschnittstellen.
Eine Umarbeitung liegt nach § 69c Nr. 2 UrhG dann vor, wenn durch äußeres Einwirken die Struktur oder der Code eines Programms abgeändert wird. Dies setzt voraus, dass der betroffene Gegenstand (also das mutmaßlich geschützte Programm) klar bestimmt ist und dessen schutzbegründende Merkmale identifiziert sind.
2. Kritik an der Berufungsentscheidung
Der BGH beanstandet, dass das OLG Hamburg die Entscheidung ohne hinreichende Bestimmung des Schutzgegenstands getroffen hat. Unklar blieb, ob und inwieweit die im Browser erzeugten Datenstrukturen (DOM, CSSOM, Render Tree) als Ausdrucksform des Programms der Klägerin Teil des urheberrechtlich geschützten Codes sind.
Zwar sei es grundsätzlich möglich, den urheberrechtlichen Schutz zu unterstellen und allein das Vorliegen einer Verletzung zu verneinen. Diese Möglichkeit besteht aber nur dann, wenn der unterstellte Schutzgegenstand samt seinen schutzbegründenden Merkmalen hinreichend konkretisiert ist. Das war hier nicht der Fall.
Der BGH erkennt an, dass sich die vom Werbeblocker veränderten Strukturen nicht lediglich als bloße Rechenergebnisse darstellen, sondern möglicherweise als vom Webseitenprogramm erzeugter und vom Browser ausführbarer Code, mithin als Bytecode im weiteren Sinne. Dieser könne unter bestimmten Voraussetzungen urheberrechtlich geschützt sein, vergleichbar dem Objektcode klassischer Software.
3. Vorbringen der Klägerin und unionsrechtlicher Kontext
Besonders gewichtig ist das Argument der Klägerin, dass sich das Webseitenprogramm nicht in statischem HTML erschöpft, sondern durch Skriptsprachen und browserseitige Interpretation dynamisch veränderbare Steuerstrukturen erzeugt, die weiterhin Ausdruck des vom Verlag erstellten Programmcodes seien. Die Klägerin verwies hierzu auch auf die Rolle virtueller Maschinen (Browser), in denen der Bytecode interpretiert wird – eine Analogie zur Java-Architektur.
Diesen technisch fundierten Vortrag hat das Berufungsgericht nicht gewürdigt. Der BGH verlangt, dass im weiteren Verfahren konkret geprüft wird, ob und welche Bestandteile des Browser-Verhaltens auf schutzfähigem Code der Klägerin beruhen und ob der Werbeblocker gezielt in diese Ausdrucksformen eingreift.
4. Keine abschließende Entscheidung – Zurückverweisung
Weil der Schutzbereich des mutmaßlich betroffenen Computerprogramms nicht hinreichend bestimmt wurde, war dem BGH eine abschließende Beurteilung verwehrt. Die Sache wurde daher zur weiteren Aufklärung an das OLG Hamburg zurückverwiesen. Das Berufungsgericht muss nun aufklären,
- ob das Webseitenprogramm der Klägerin in die Kategorie des urheberrechtlich geschützten Computerprogramms fällt;
- ob die betroffenen Datenstrukturen dem Webseitenprogramm zurechenbar sind;
- ob die Eingriffe des Werbeblockers eine Umarbeitung oder abändernde Vervielfältigung darstellen;
- ob die Klägerin über die ausschließlichen Nutzungsrechte verfügt;
- ob ggf. eine gesetzliche Erlaubnis nach § 69d Abs. 1 UrhG oder § 44a UrhG greift.

Die Kernaussage lautet: Dynamisch generierter Code im Browser kann schutzfähig sein – aber nur, wenn er klar dem geschützten Programm zugeordnet werden kann. Werbeblocker-Eingriffe sind nicht automatisch legal – sie bedürfen sorgfältiger Prüfung im Einzelfall.
Resümee
Der Bundesgerichtshof hebt mit dieser Entscheidung die dogmatischen Anforderungen an die urheberrechtliche Beurteilung dynamischer Webseitenprogramme deutlich an. Die schlichte Trennung zwischen Programmcode und Ausführung im Browser greift zu kurz, wenn gerade der browserseitige Codeausdruck funktionale Substanz und kreative Struktur des Programms trägt. Werbeblocker, die gezielt in diesen Ablauf eingreifen, können eine Umarbeitung im urheberrechtlichen Sinne darstellen – jedenfalls dann, wenn die veränderten Strukturen selbst Ausdruck des geschützten Codes sind.
Die Entscheidung stärkt damit die Schutzposition komplexer Webanwendungen, ohne den rechtmäßigen Gebrauch von Werbeblockern per se zu unterbinden. Sie verlangt aber eine präzise technik- und rechtsdogmatisch fundierte Prüfung, wann eine dynamische Webseite urheberrechtlich als Computerprogramm zu behandeln ist – und wann deren gezielte Beeinflussung durch Drittsoftware als Eingriff in den Schutzbereich zu qualifizieren ist.
- Veränderungssperren bei Software-Besichtigungen - Oktober 6, 2025
- Cybersecurity in der Software-Lieferkette - September 24, 2025
- Software Bill of Materials (SBOM) - September 14, 2025