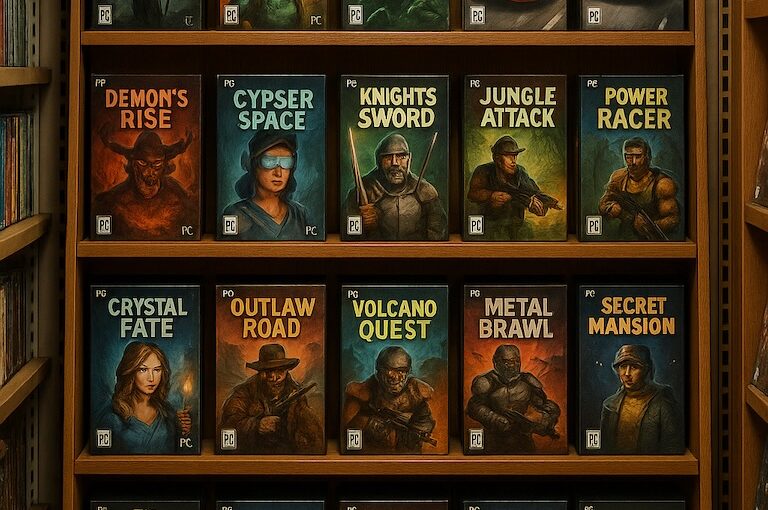Anforderungen an Unterscheidungskraft und Verwechslungsgefahr bei Titel für Computerspielen: Die wirtschaftliche Bedeutung von Computerspielen als Kulturgüter und Handelsobjekte stellt das Kennzeichenrecht regelmäßig vor neue Herausforderungen. Der rechtliche Schutz von Spieltiteln, insbesondere gegen Nachahmung oder marktschädliche Anlehnung, wirft dabei komplexe und spannende Abgrenzungsfragen auf.
In einer aktuellen Entscheidung (LG Hamburg, Urt. v. 03.07.2025 – 327 O 298/24) befasst sich nun das Landgericht Hamburg mit dem Umfang und der Priorität eines Werktitelrechts an einem Computerspiel. Im Zentrum steht die Frage, ob der Titel „RAFT“, unter dem die Klägerin seit Ende 2016 ein Open-World-Survival-Spiel vertreibt, gegenüber später erschienenen Handyspielen mit ähnlichen Bezeichnungen schutzfähig ist. Die Entscheidung bietet eine instruktive dogmatische Klärung zu Voraussetzungen und Reichweite des Titelschutzes bei Softwareprodukten.
Worum geht es?
Die Klägerin entwickelt und vertreibt ein Computerspiel mit dem Titel „RAFT“, in dem der Spieler in einer Meeresumgebung auf einem Floß überleben muss. Bereits im Dezember 2016 wurde eine erste Version des Spiels über eine Plattform veröffentlicht. Es folgten hohe Downloadzahlen und eine stetige Weiterentwicklung, unter anderem mit einem Steam-Release im Mai 2018.
Die Beklagte zu 1) bietet seit April 2017 unter den Bezeichnungen „RAFT“, „RAFT Survival“, „RAFT Survival – Ocean Nomad“ und „RAFT Survival – Desert Nomad“ ein Handyspiel an. Die Klägerin sieht hierin eine Verletzung ihres Werktitelrechts, da zwischen den Titeln Verwechslungsgefahr bestehe. Neben einem Unterlassungsanspruch macht sie auch Schadensersatz und Ersatz von Abmahnkosten geltend. Der Beklagte zu 2), Geschäftsführer der Beklagten zu 1), wurde ebenfalls in Anspruch genommen.
Juristische Analyse
I. Schutzfähigkeit des Titels „RAFT“
Zentral für den Unterlassungsanspruch nach § 15 Abs. 2 MarkenG ist das Bestehen eines Werktitelrechts. Nach § 5 Abs. 3 MarkenG können auch Softwareprodukte titelschutzfähige Werke sein, sofern sie eine geistige Leistung darstellen und der Titel unterscheidungskräftig ist.
Das Gericht bejaht die Unterscheidungskraft der Bezeichnung „RAFT“. Zwar enthält der Begriff einen beschreibenden Bezug zur Spielmechanik – das Überleben auf einem Floß –, er beschreibt den Spielinhalt jedoch nicht erschöpfend. Gerade bei Computerspielen, insbesondere im Genre der „Survival Games“, sind assoziative Titel üblich, die einen inhaltlichen Bezug suggerieren, ohne das Werk vollständig zu beschreiben. Die Verwendung anderer Spiele mit ähnlichen Titeln wie „RAFT Survival“ oder „Raft Wars“ aus der Vergangenheit steht der Schutzfähigkeit nicht entgegen, da es an einer Verwässerung im markenrechtlichen Sinne fehle.
II. Prioritätsfrage und Benutzungsaufnahme
Werktitelschutz entsteht nicht mit der bloßen Planung oder Ankündigung, sondern erst mit der tatsächlichen Benutzung im geschäftlichen Verkehr, also mit der Veröffentlichung eines zumindest weitgehend fertiggestellten Werks. Der Schutz hängt dabei vom Werktyp und der Verkehrserwartung ab.
Das Gericht qualifiziert die auf „itch.io“ im Dezember 2016 veröffentlichte Version von „RAFT“ als titelschutzfähige Erstveröffentlichung. Es handelte sich um ein öffentlich abrufbares, spielbares Produkt, das bereits alle prägenden Spielmechaniken enthielt. Die späteren Weiterentwicklungen – etwa der Steam-Release 2018 – führten nicht zu einem neuen Werktitel, sondern zu einer Fortentwicklung desselben Spiels. Damit konnte die Klägerin eine Benutzungsaufnahme und Priorität jedenfalls vor der Erstveröffentlichung der Beklagten zu 1) am 28.04.2017 für sich beanspruchen.
Das Gericht grenzt diesen Fall ausdrücklich von der BGH-Entscheidung „FTOS“ (GRUR 1997, 902) ab, in der die Bereitstellung von Software für Pilotkunden noch nicht als titelschutzbegründend anerkannt wurde. Im vorliegenden Fall stand das Spiel jedoch der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung und wurde millionenfach heruntergeladen – darunter auch in Deutschland.
III. Verwechslungsgefahr
Maßgeblich für die Begründetheit des Unterlassungsanspruchs ist sodann die Verwechslungsgefahr zwischen den einander gegenüberstehenden Titeln. Entscheidend ist hierbei nicht nur die Zeichenähnlichkeit, sondern auch die Werkähnlichkeit und die Kennzeichnungskraft des älteren Titels.
Das Gericht erkennt eine mindestens durchschnittliche Kennzeichnungskraft von „RAFT“ an und bejaht eine hochgradige Werkähnlichkeit zwischen Computer- und Handyspielen. Aus Sicht des Publikums handelt es sich um substituierbare Produkte, die sich primär in der Plattform (stationär vs. mobil), nicht aber im Inhalt unterscheiden. Eine Differenzierung nach Entwicklerinteressen, Vertriebskanälen oder Einnahmemodellen – wie von den Beklagten betont – ist demgegenüber irrelevant.
Auch die von der Beklagten gewählten Zusätze wie „Survival“ oder „Ocean Nomad“ seien rein beschreibend und würden die Verwechslungsgefahr eher verstärken, da sie die thematische Nähe zum Spielkonzept der Klägerin unterstreichen. Besonderes Gewicht legt das Gericht auf die grafische Hervorhebung von „RAFT“ als Kernelement des Titels (z. B. mit einem „R im Kreis“), wodurch sich der Verkehr auf diesen Bestandteil konzentriere.
Lediglich bei der Bezeichnung „RAFT Survival – Desert Nomad“ verneint das Gericht eine unmittelbare Verwechslungsgefahr, da der Zusatz „Desert“ einen inhaltlichen Bruch mit dem Setting eines Spiels auf einem Floß im Meer bewirke.
IV. Anspruchsdurchsetzung und Verjährung
Der Unterlassungsanspruch sei nicht verjährt, da die fortdauernde Nutzung des Titels durch die Beklagte eine Dauerhandlung darstelle, bei der die Verjährung nicht mit der Erstverletzung beginnt. Auch der geltend gemachte Schadensersatzanspruch (§ 15 Abs. 5 MarkenG) sei nicht verjährt, da die Klägerin erst 2021 konkrete Kenntnis von der Nutzung des Titels durch die Beklagte zu 1) in Deutschland erlangt habe. Die Ersatzpflicht für vorgerichtliche Abmahnkosten wurde anteilig zugesprochen.
Die Klage gegen den Beklagten zu 2) blieb indes ohne Erfolg, da seine Rolle auf technische Aufgaben begrenzt war und er an der Auswahl des Titels nicht beteiligt war.

Konsequenzen und Einordnung
Das Urteil konkretisiert in überzeugender Weise die Voraussetzungen für den Werktitelschutz bei digitalen Kulturgütern. Es stellt klar, dass weder eine gewisse Allgemeinverständlichkeit noch eine thematische Nähe zur Werkart per se gegen eine Schutzfähigkeit sprechen. Entscheidend ist vielmehr die Verkehrsfähigkeit des Titels und seine Eigenprägung im Kontext der Werkverwendung.
Computerspiele sind allgemein werktitelfähig. Der Titelschutz für Spiele ist anerkannt, sofern das Spiel einen umsetzungsfähigen geistigen Gehalt aufweist, der für die Wahrnehmung des Spiels durch die Öffentlichkeit wesentlich ist und den wahren Charakter der konkreten Verkörperung der Spielidee in den Hintergrund treten lässt. Bei Computerspielen bestehen daran keine Bedenken, da sie einen hochkomplexen Spielstoff liefern, der das strategische Denken und die Spiellust der Benutzer anspricht und in der Regel eine anspruchsvolle Umsetzung der Spielidee erfordert. Dies steht zwischen den Parteien auch nicht in Streit. Für die Praxis bedeutet die vorliegende Entscheidung abschließend: Anbieter digitaler Inhalte sollten frühzeitig prüfen, ob der gewählte Titel bereits durch Dritte genutzt wird, und im Zweifel die Entwicklung phantasievoller, originärer Bezeichnungen bevorzugen. Andernfalls drohen Unterlassungsansprüche sowie mögliche Rückruf- oder Schadensersatzforderungen.
Schlussfolgerung
Die Entscheidung des LG Hamburg liefert eine differenzierte und überzeugende Auslegung der Grundsätze des Werktitelschutzes für digitale Produkte. Sie unterstreicht, dass auch beschreibende oder inhaltsnahe Bezeichnungen wie „RAFT“ titelschutzfähig sein können, sofern sie nicht ausschließlich beschreibend sind und die Veröffentlichung eines spielfähigen Prototyps erfolgt ist. Gleichzeitig verdeutlicht das Gericht, dass der Schutzbereich von Werktiteln nicht auf eine einzelne Plattform oder bestimmte Werkform beschränkt ist, wenn der Verkehr inhaltliche Identität erwartet.
Die Bilanz: Ein sorgfältig begründetes Urteil, das Entwicklern von digitalen Inhalten einen soliden Rahmen für den Schutz ihrer Produktbezeichnungen bietet und die Anforderungen an die Entstehung von Werktitelschutz im Bereich interaktiver Software praxisnah konturiert.
- Veränderungssperren bei Software-Besichtigungen - Oktober 6, 2025
- Cybersecurity in der Software-Lieferkette - September 24, 2025
- Software Bill of Materials (SBOM) - September 14, 2025