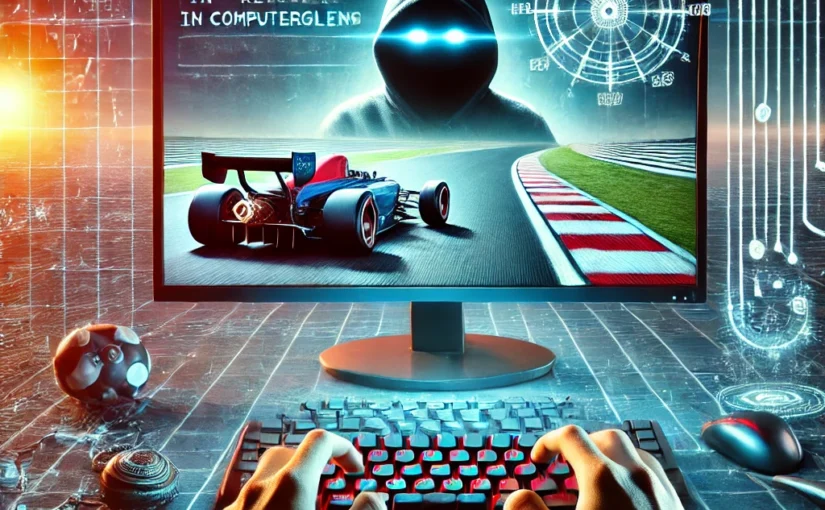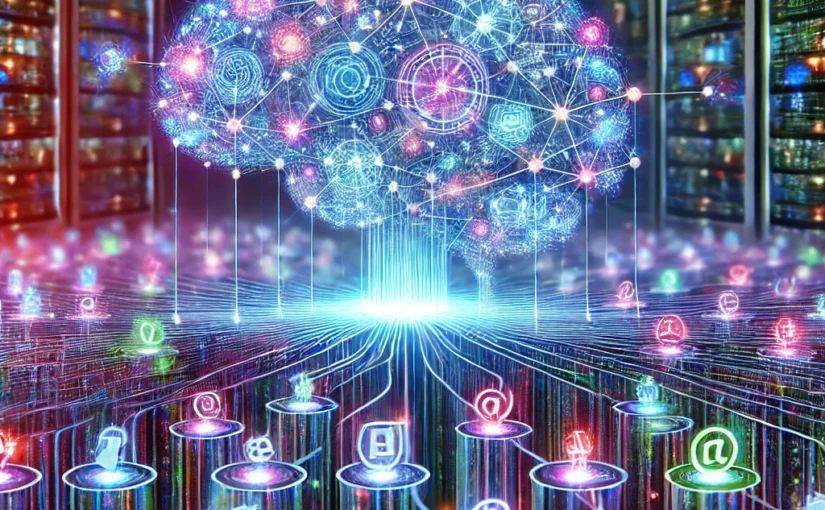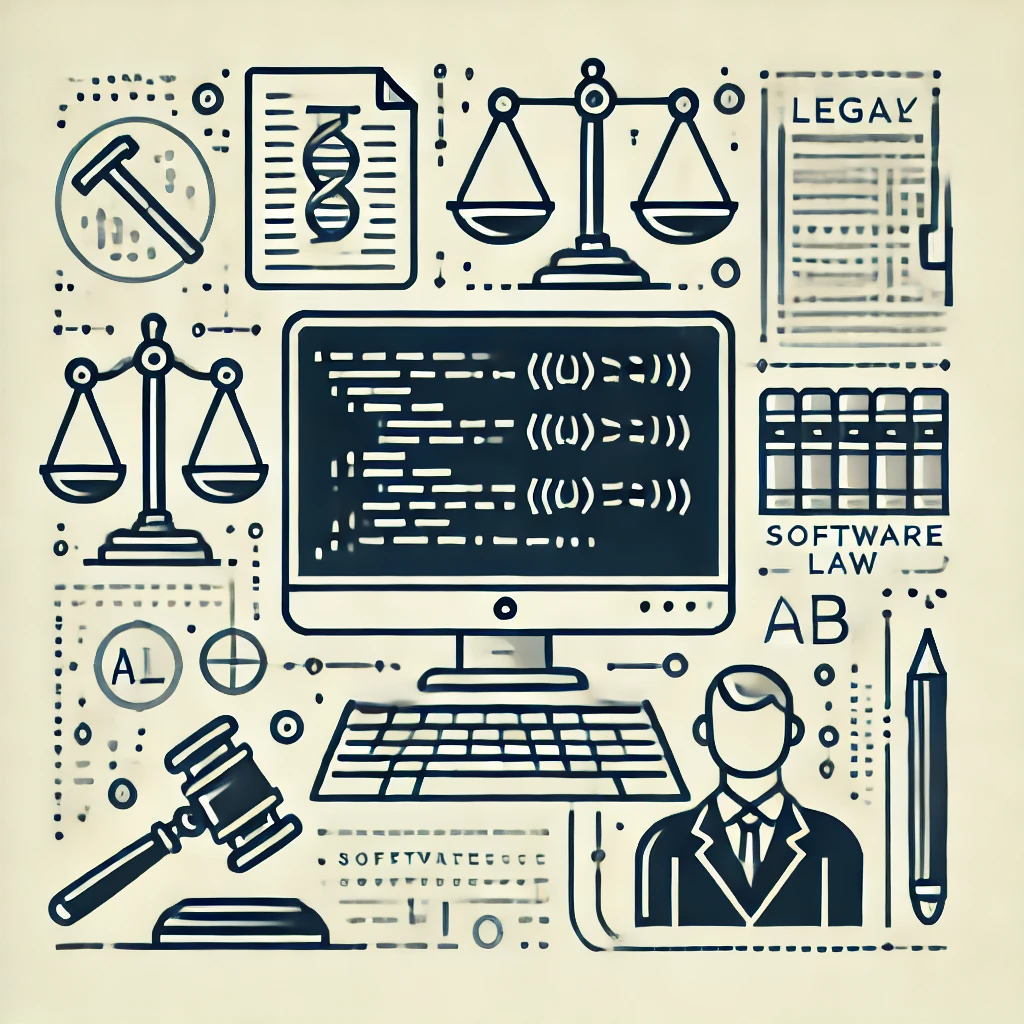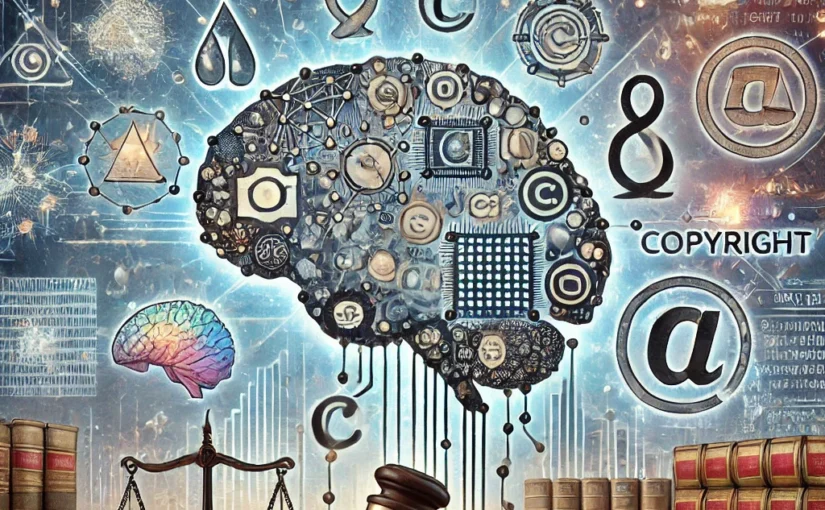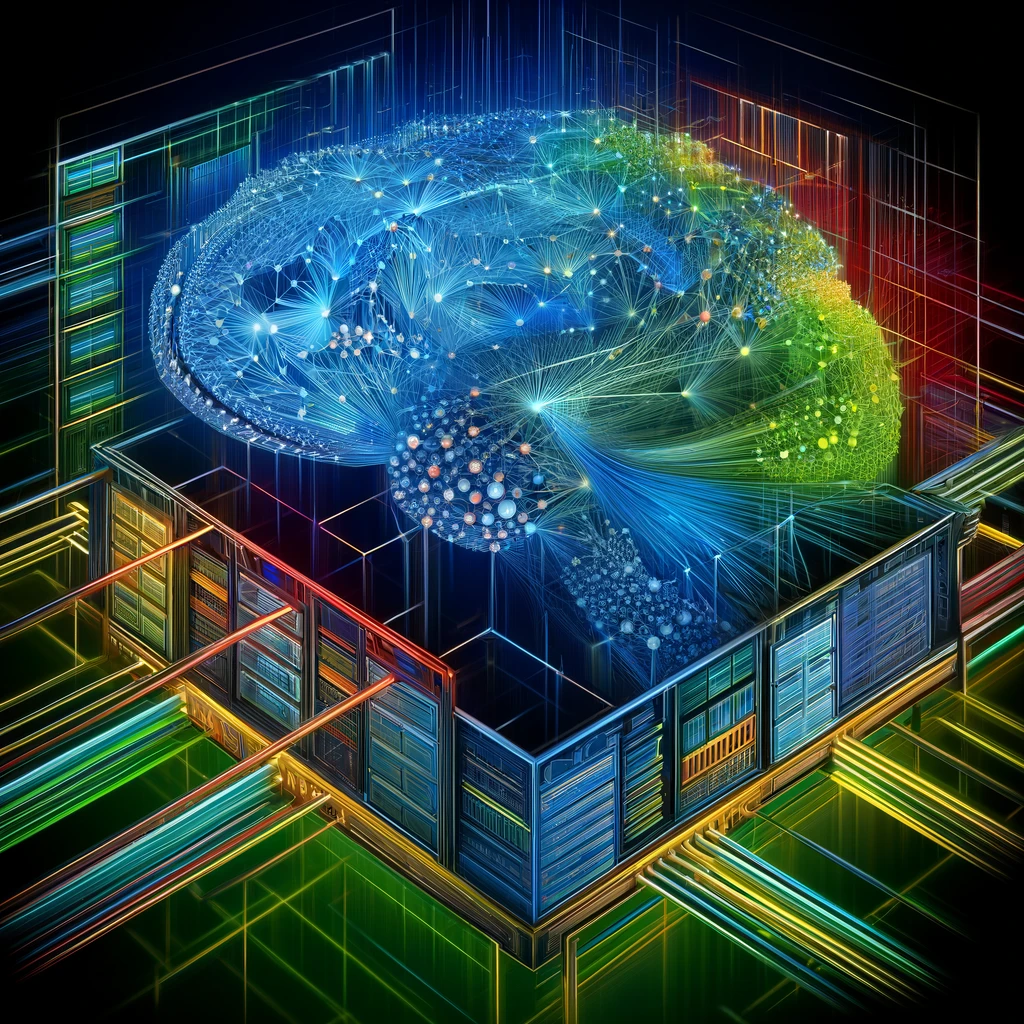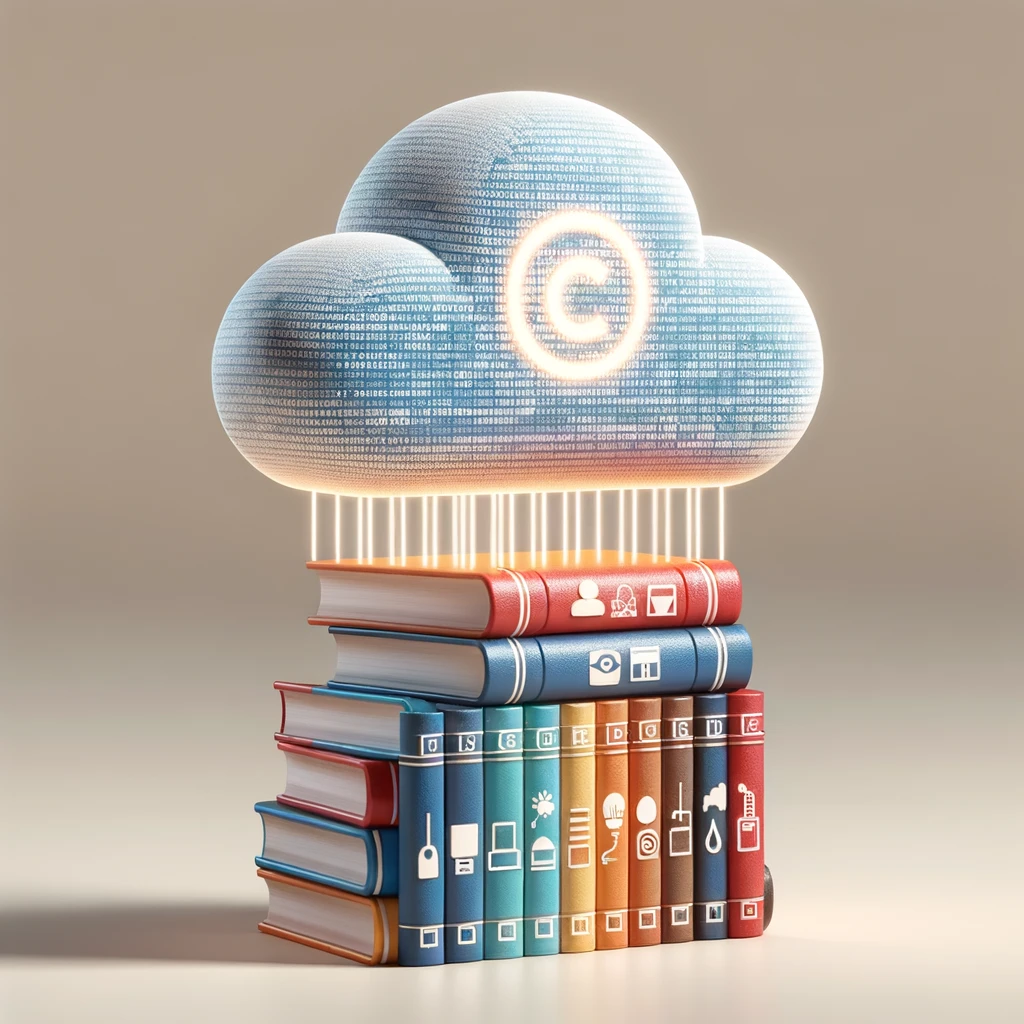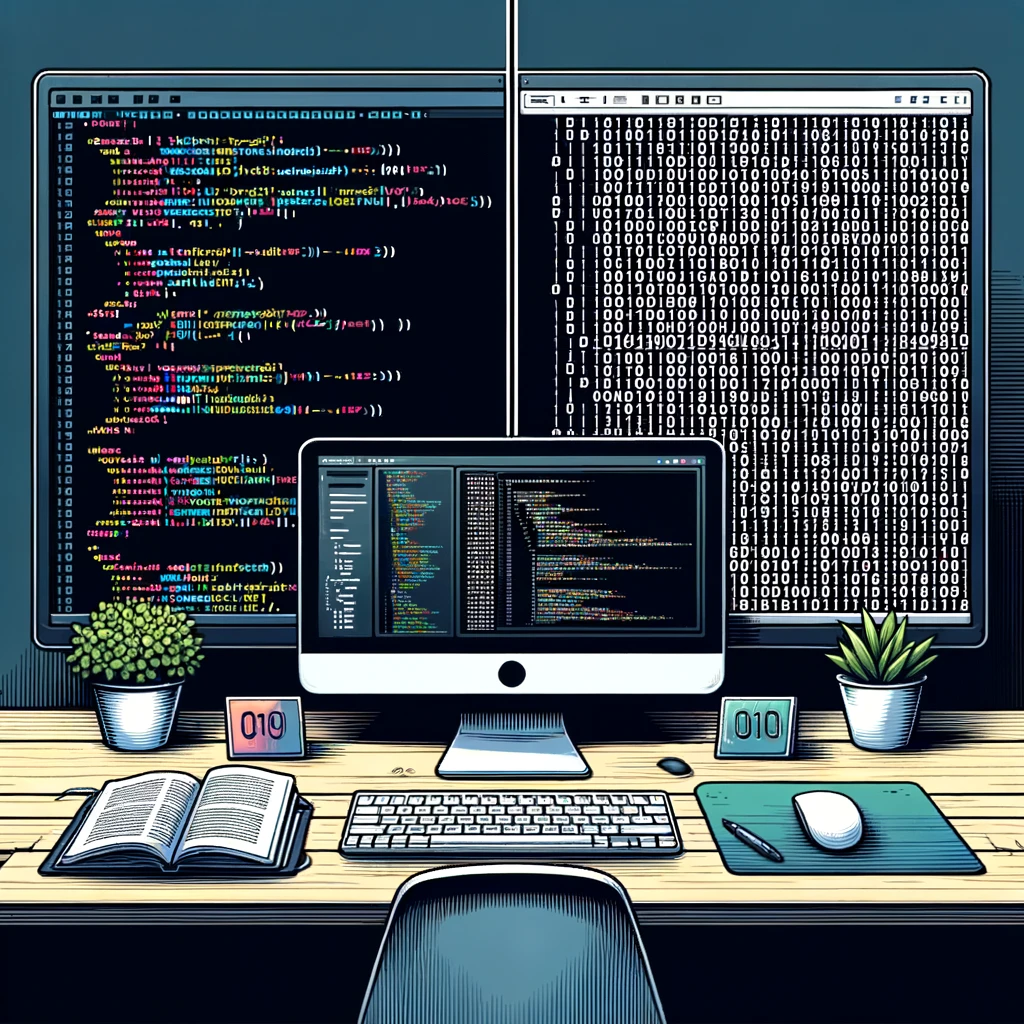Am 17. Oktober 2024 entschied der Europäische Gerichtshof (EuGH) in der Rechtssache C-159/23 über zentrale Fragen des Urheberrechtsschutzes von Computerprogrammen. Die Entscheidung beleuchtet, ob Eingriffe in den Arbeitsspeicher eines Computers, um Gameplay-Elemente zu verändern, eine unzulässige Umarbeitung im Sinne der Richtlinie 2009/24/EG darstellen. Das Urteil hat weitreichende Implikationen für Hersteller von Computerspielen, Entwickler von Zusatzsoftware sowie die Gaming-Community.
Cheating bei Computerspielen: EuGH zur Umarbeitung von Computerspielen weiterlesenKategorie: Urheberrecht
Urheberrechtliche Relevanz der Aufnahme eines Fotos in einen KI-Trainingsdatensatz
Ein aktuelles Urteil des Landgerichts Hamburg (LG Hamburg, Urteil vom 27.09.2024 – 310 O 227/23) beschäftigt sich mit einer urheberrechtlichen Streitigkeit im Kontext der Nutzung eines Bildes in einem für das Training von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellten Datensatz.
Es gilt: Die Aufnahme eines urheberrechtlich geschützten Fotos in einen Trainingsdatensatz für KI-Systeme stellt eine Vervielfältigung dar und benötigt daher grundsätzlich die Zustimmung des Urhebers
Urheberrechtliche Relevanz der Aufnahme eines Fotos in einen KI-Trainingsdatensatz weiterlesenÜberblick über das Softwarerecht in Deutschland: Wichtige rechtliche Probleme bei der Softwareentwicklung und -vermarktung
Deutschland, als eine der größten Volkswirtschaften in Europa, hat ein robustes rechtliches Rahmenwerk für die Entwicklung und den Vertrieb von Software. Ein Verständnis der rechtlichen Fragen im Zusammenhang mit Software in diesem Land ist entscheidend für Entwickler, Unternehmen und Vertriebspartner, die auf dem deutschen Markt tätig sind. Auf Grundlage jüngster Blogposts soll dieser Artikel einen Überblick über das deutsche Softwarerecht geben und dabei auf die häufigen rechtlichen Probleme eingehen, mit denen Unternehmen konfrontiert sind.
Überblick über das Softwarerecht in Deutschland: Wichtige rechtliche Probleme bei der Softwareentwicklung und -vermarktung weiterlesenUrheberrechtliche Herausforderungen beim Training generativer KI-Modelle
Die Nutzung generativer KI-Modelle wie ChatGPT, DALL-E oder Stable Diffusion ist in den letzten Jahren enorm gestiegen. Diese Modelle sind in der Lage, auf Basis von Nutzeranweisungen kreative Inhalte zu generieren, wie z.B. Texte, Bilder oder Musikstücke. Diese Fähigkeit zur autonomen Kreativität basiert darauf, dass die KI-Modelle aus großen Datenmengen „gelernt“ haben, wie sie entsprechende Inhalte erstellen können. Ein erheblicher Teil dieser Datenbestände ist urheberrechtlich geschützt, was zu erheblichen rechtlichen Herausforderungen führt.
Urheberrechtliche Herausforderungen beim Training generativer KI-Modelle weiterlesenSchutz von KI
Kann künstliche Intelligenz als solche rechtlich geschützt werden? Die Frage ist keineswegs trivial – und von erheblicher wirtschaftlicher Bedeutung: Die rechtliche Problematik und Notwendigkeit des Schutzes von Datensätzen in diesem Zusammenhang liegt auf der Hand.
In einer digitalisierten Wirtschaft, in der Daten zunehmend als wertvolles Wirtschaftsgut betrachtet werden, ist der rechtliche Schutz z.B. von Datenbeständen, aber auch von Software, die mit diesen Daten arbeitet, von entscheidender Bedeutung. Nur so kann aus hiesiger Sicht die Frage der Schutzfähigkeit von KI durch eine getrennte Betrachtung von Datenbeständen und Software beantwortet werden.
Schutz von KI weiterlesenZustimmungspflichtige Nutzung bei Einsatz von Software im Cloud-Computing?
Das OLG Frankfurt (11 U 36/18) hat zu der Frage Stellung genommen, ob eine Vervielfältigung i.S.d. § 69c Nr. 1 UrhG auch dann vorliegt, wenn die Nutzung einer Software im Wege des Cloud Computing zu einer (technischen) Vervielfältigung nicht auf Rechnern im Bereich des Nutzers, sondern auf fremden Servern führt, die sich im Einflussbereich des Nutzungsberechtigten befinden.
Diese Frage ist bislang nicht höchstrichterlich entschieden. In der Literatur wird hierzu teilweise die Auffassung vertreten, dass keine Vervielfältigung durch den Nutzer vorliegt, wenn der zugreifende Client keine Kopie in den Arbeitsspeicher seines Rechners erhält oder eine Vervielfältigung des Programms ausschließlich auf dem Server des Diensteanbieters erfolgt.
Grundsätzlich stellt das Laden eines Programms in den Arbeitsspeicher eines anderen Computers nach allgemeiner Auffassung eine Vervielfältigung im Sinne von § 69c Nr. 1 UrhG dar. Tragender Gedanke ist dabei, dass durch dieses Laden eines Programms in den Arbeitsspeicher eines Computers eine weitere Nutzung des Programms durch weitere Programmkopien ermöglicht wird.
Das OLG ist nun der Auffassung, dass die Beantwortung der Frage, ob beim Cloud Computing eine urheberrechtlich relevante Vervielfältigungshandlung vorliegt, nicht allein davon abhängig gemacht werden kann, in wessen Einflussbereich sich der Computer befindet, auf dem die Vervielfältigung erfolgt.
Nach § 69c Nr. 1 Satz 2 UrhG ist die Zustimmung des Rechtsinhabers immer dann erforderlich, wenn das „Laden, Anzeigen, Ablaufen, Übertragen oder Speichern“ des Programms eine Vervielfältigung erfordert. Das Vervielfältigungsrecht gehört zu den grundlegenden Verwertungsrechten des Urhebers (§§ 15 Abs. 1 Nr. 1, 16 UrhG). Eine Vervielfältigung hat grundsätzlich zur Folge, dass das Vervielfältigungsstück in gleicher Weise wie das Werk selbst genutzt (z.B. betrachtet, gelesen, gehört ….) werden kann. Sie ermöglicht also einen zusätzlichen Werkgenuss.
Vor diesem Hintergrund ist auch die ratio des § 69c Nr. 1 UrhG zu sehen: Der bloße „Werkgenuss“ stellt auch bei Computerprogrammen keine urheberrechtlich relevante Nutzungshandlung dar. Hat ein Nutzer ein Programm rechtmäßig erworben und stationär auf seinem eigenen PC installiert, so wird kein Urheberrecht verletzt, wenn er einen Dritten auf diesem PC mit diesem Programm arbeiten lässt, ebenso wenig, wenn er einen Dritten dort einen von ihm erworbenen Film ansehen lässt (das OLG verweist insoweit auf BGH, I ZR 139/89). Urheberrechtlich relevant wird die Nutzung durch den Dritten erst dann, wenn diesem durch eine Vervielfältigung des Programms eine weitere Nutzung ermöglicht wird. Dieser Gesetzeszweck greift nach Auffassung des OLG aber unabhängig davon ein, in wessen Sphäre die für die zusätzliche Nutzung erforderliche Vervielfältigung erfolgt.
Urheberrechtliche Schutzfähigkeit eines Computerprogramms
Das OLG Frankfurt (11 U 36/18) hatte Gelegenheit, sich zu der Frage zu äußern, wann ein Computerprogramm urheberrechtlich schutzfähig ist, was das Vorliegen eines individuellen Werks in dem Sinne voraussetzt, dass es das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung seines Urhebers ist (§ 69a Abs. 3 UrhG).
Urheberrechtliche Schutzfähigkeit eines Computerprogramms weiterlesenGebrauchte Software: Beweislast bei wettbewerbswidriger Bewerbung von Produktschlüsseln
Die Unrichtigkeit einer beanstandeten Werbeaussage ist eine anspruchsbegründende Tatsache, die grundsätzlich vom Anspruchsteller zu beweisen ist. Vor dem Hintergrund des Art. 7 der Richtlinie 2006/114/EG über irreführende und vergleichende Werbung können dem Kläger jedoch Darlegungs- und Beweiserleichterungen zugute kommen, soweit es sich um Tatsachen handelt, die in den Verantwortungsbereich des Werbenden fallen.
Gebrauchte Software: Beweislast bei wettbewerbswidriger Bewerbung von Produktschlüsseln weiterlesenUrheberrechtlicher Schutz von Software
Urheberrechtlicher Schutz von Software: Entsprechend § 69a Abs. 3 UrhG wird eine Software (“Computerprogramme´”) urheberrechtlich geschützt, wenn sie insoweit ein individuelles Werk darstellt, dass sie das Ergebnis der eigenen geistigen Schöpfung ihres Urhebers ist. Doch wann genau besteht ein Urheberrechtlicher Schutz von Software?
Urheberrechtlicher Schutz von Software weiterlesenBGH: Einsichtsrecht in Software-Quelltext bei vermuteter Urheberrechtsverletzung
Wer als Rechteinhaber Urheberrechte an einer Software hat und sich mit einer vermeintlichen Rechtsverletzung konfrontiert sieht, kann zur Klärung, ob wirklich eine Rechtsverletzung vorliegt, Einblick in den Quelltext der Software des Verletzers nehmen. Dies im Zuge eines “Besichtigungsrechts”, das im BGB seit jeher im Sachenrecht existiert. Dabei stellt sich die Frage, wie die Einsichtnahme in das digitale Beweismittel Quelltext stattzufinden hat.
BGH: Einsichtsrecht in Software-Quelltext bei vermuteter Urheberrechtsverletzung weiterlesen