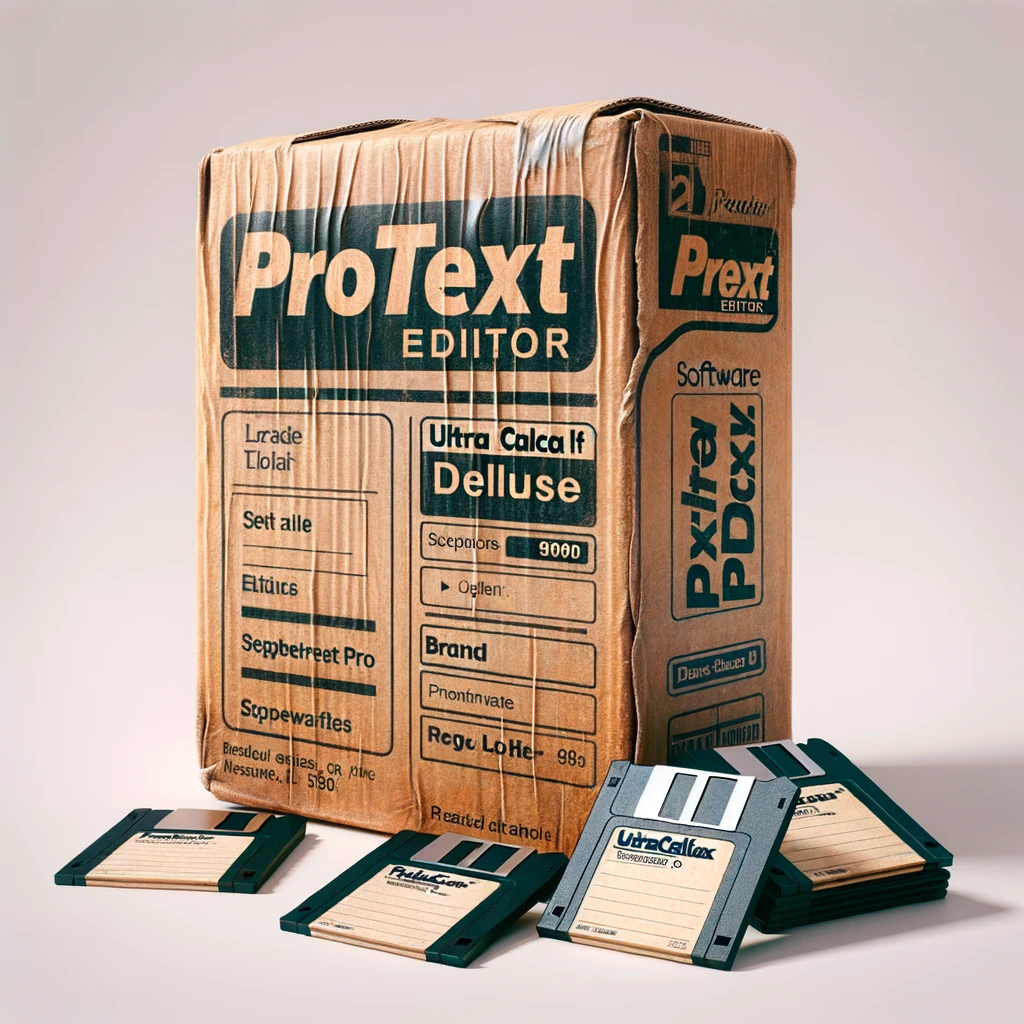Superlative in der Werbung: Wenn „einfachste und effizienteste“ zu weit geht – Werbeaussagen mit Superlativen wie „das einfachste und effizienteste Lernmanagementsystem“ sind ein klassisches Mittel, um Kunden zu überzeugen. Doch was aus Marketingsicht verlockend klingt, kann wettbewerbsrechtlich problematisch sein.
Das Oberlandesgericht Koblenz hat in einem aktuellen Urteil vom 8. Juli 2025 (Az. 9 U 443/25) klargestellt, dass solche Spitzenstellungsbehauptungen nur unter strengen Voraussetzungen zulässig sind. Die Entscheidung betrifft einen Streit zwischen zwei Anbietern von Lernmanagement-Systemen (LMS) und wirft grundsätzliche Fragen zur Zulässigkeit von Alleinstellungswerbung, zur Dringlichkeit im einstweiligen Rechtsschutz und zur Abgrenzung zwischen legitimer Werbung und irreführender Geschäftspraxis auf.
Spitzenstellungsbehauptung bei Software weiterlesen