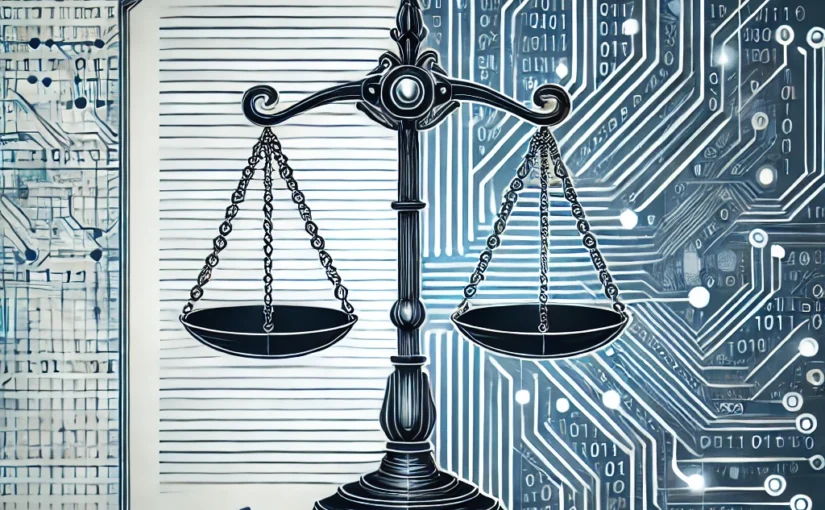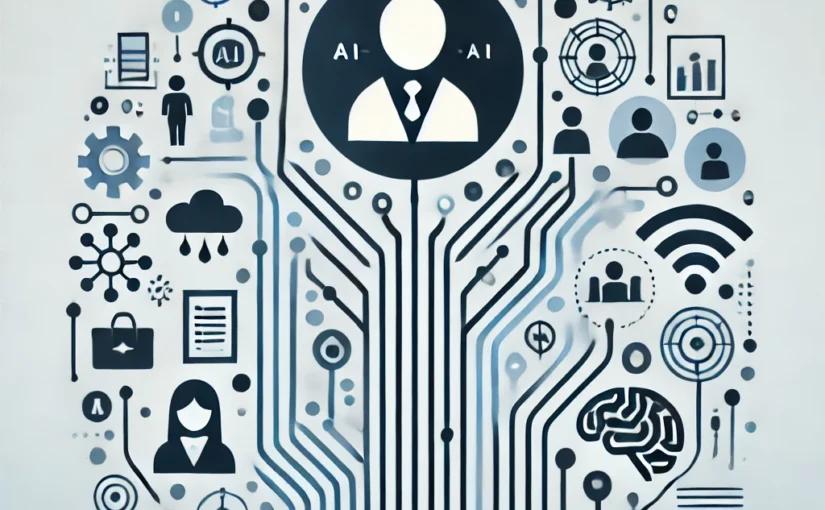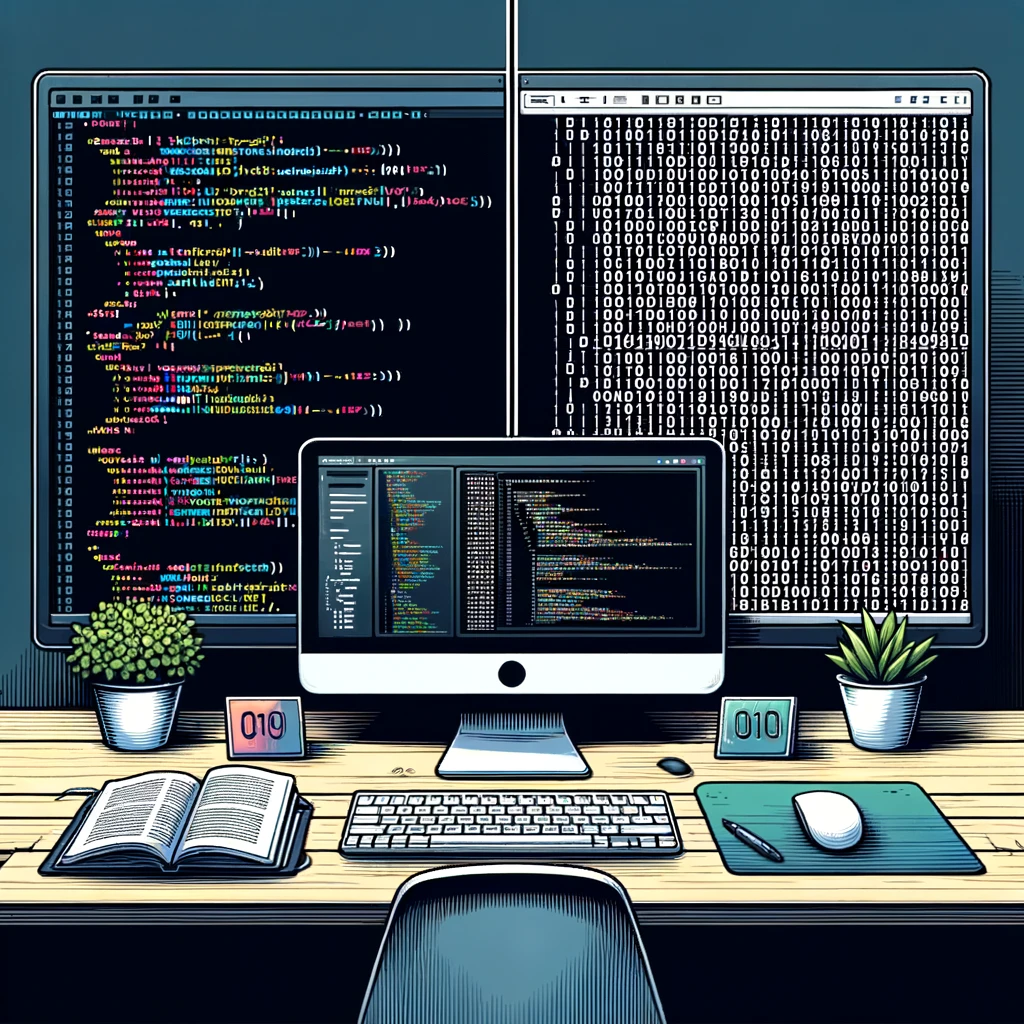Ein aktuelles BSI-Whitepaper zu Designprinzipien für LLM-basierte Systeme mit „Zero Trust“-Ansatz enthält zentrale Empfehlungen zur sicheren Implementierung von KI-Systemen in Unternehmen und Behörden. Die Vorgaben reichen von der Authentifizierung und dem Input-/Output-Schutz bis hin zum Monitoring und Hintergrundwissen für die Awareness.
Doch Vorsicht, diese Empfehlungen sind mehr als reine IT-Empfehlungen: Sie berühren unmittelbar haftungsrechtliche Fragen und betreffen die konkrete Umsetzung datenschutzrechtlicher Vorgaben gemäß Art. 25 DSGVO („Privacy by Design“ und „Privacy by Default“).
Designprinzipien für LLM-basierte Systeme des BSI weiterlesen