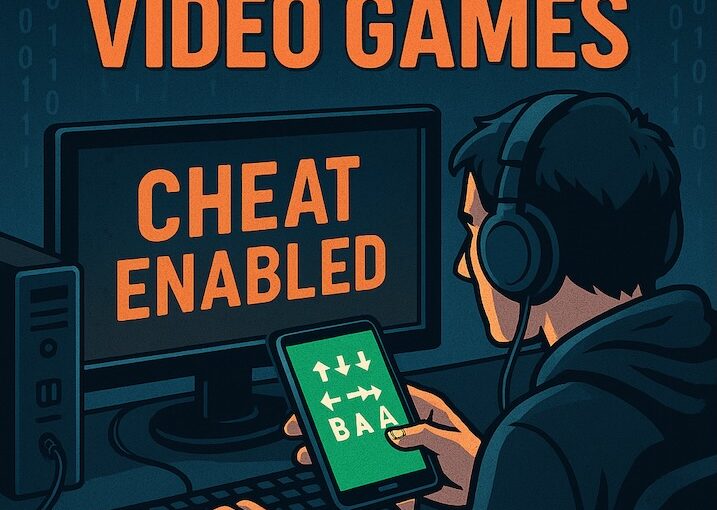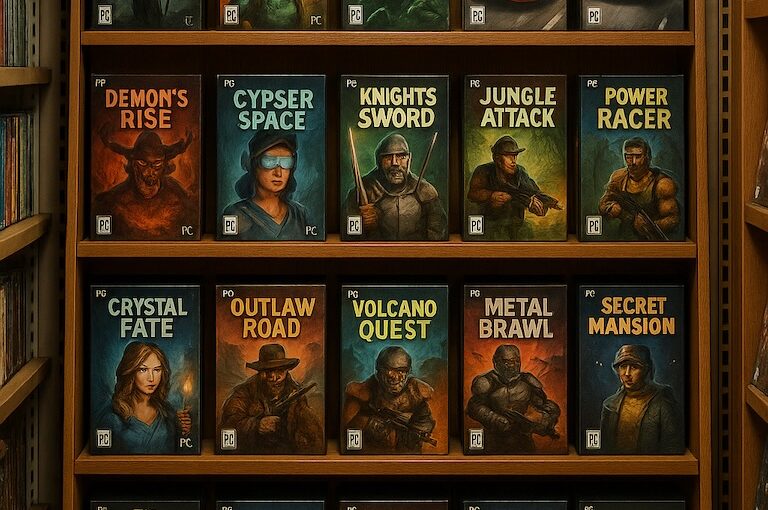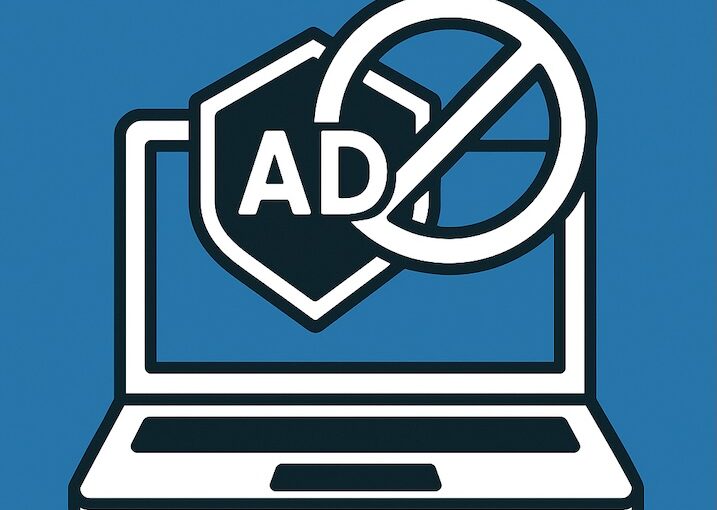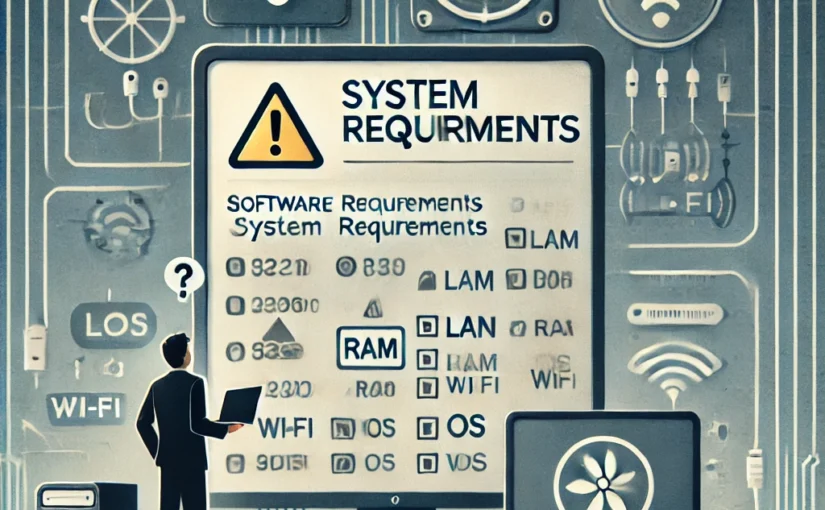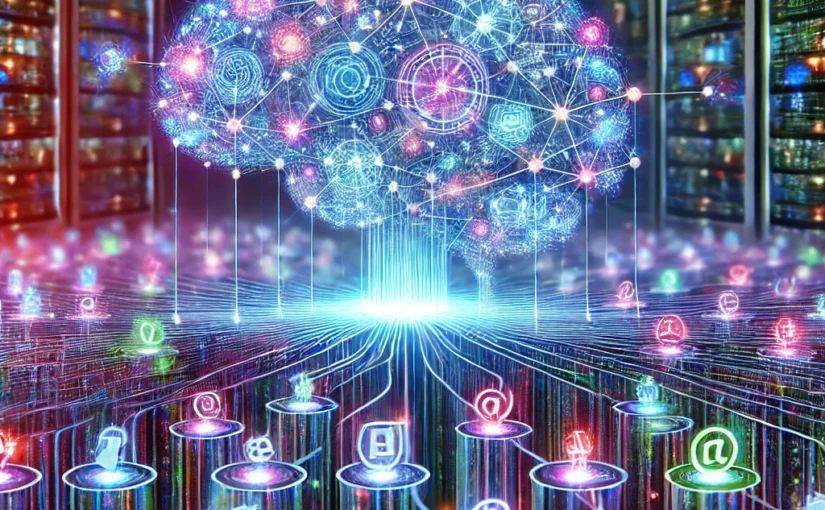Die jüngsten Angriffe auf die JavaScript-Bibliotheksplattform npm zeigen auf dramatische Weise, wie verwundbar moderne Software-Lieferketten sind. Ein selbstvermehrender Wurm namens Shai-Hulud hat Hunderte von Code-Paketen infiziert, Zugangsdaten gestohlen und diese öffentlich zugänglich gemacht. Für Unternehmen und ihre Führungskräfte wirft dies nicht nur technische, sondern auch erhebliche rechtliche und haftungsrelevante Fragen auf. Was ist passiert, welche Risiken bestehen für Unternehmen, und wie können sich Verantwortliche absichern?
Cybersecurity in der Software-Lieferkette weiterlesenSchlagwort: Klage
Spitzenstellungsbehauptung bei Software
Superlative in der Werbung: Wenn „einfachste und effizienteste“ zu weit geht – Werbeaussagen mit Superlativen wie „das einfachste und effizienteste Lernmanagementsystem“ sind ein klassisches Mittel, um Kunden zu überzeugen. Doch was aus Marketingsicht verlockend klingt, kann wettbewerbsrechtlich problematisch sein.
Das Oberlandesgericht Koblenz hat in einem aktuellen Urteil vom 8. Juli 2025 (Az. 9 U 443/25) klargestellt, dass solche Spitzenstellungsbehauptungen nur unter strengen Voraussetzungen zulässig sind. Die Entscheidung betrifft einen Streit zwischen zwei Anbietern von Lernmanagement-Systemen (LMS) und wirft grundsätzliche Fragen zur Zulässigkeit von Alleinstellungswerbung, zur Dringlichkeit im einstweiligen Rechtsschutz und zur Abgrenzung zwischen legitimer Werbung und irreführender Geschäftspraxis auf.
Spitzenstellungsbehauptung bei Software weiterlesenCheats: Keine Urheberrechtsverletzung durch externe Speicher-Manipulation
In einer vielbeachteten Entscheidung vom 31. Juli 2025 (BGH, Urt. v. 31.07.2025 – I ZR 157/21 – Action Replay II) hat der Bundesgerichtshof (nochmals) die urheberrechtliche Reichweite des Schutzes von Computerprogrammen präzisiert. Im Mittelpunkt stand die Frage, ob die Modifikation von Arbeitsspeicherinhalten durch Drittsoftware – ohne Veränderung des Quell- oder Objektcodes – eine unzulässige Umarbeitung im Sinne des § 69c Nr. 2 UrhG darstellt. Der BGH verneinte dies und folgte damit der Vorabentscheidung des EuGH.
Cheats: Keine Urheberrechtsverletzung durch externe Speicher-Manipulation weiterlesenWerktitelverletzung bei Computerspielen
Anforderungen an Unterscheidungskraft und Verwechslungsgefahr bei Titel für Computerspielen: Die wirtschaftliche Bedeutung von Computerspielen als Kulturgüter und Handelsobjekte stellt das Kennzeichenrecht regelmäßig vor neue Herausforderungen. Der rechtliche Schutz von Spieltiteln, insbesondere gegen Nachahmung oder marktschädliche Anlehnung, wirft dabei komplexe und spannende Abgrenzungsfragen auf.
In einer aktuellen Entscheidung (LG Hamburg, Urt. v. 03.07.2025 – 327 O 298/24) befasst sich nun das Landgericht Hamburg mit dem Umfang und der Priorität eines Werktitelrechts an einem Computerspiel. Im Zentrum steht die Frage, ob der Titel „RAFT“, unter dem die Klägerin seit Ende 2016 ein Open-World-Survival-Spiel vertreibt, gegenüber später erschienenen Handyspielen mit ähnlichen Bezeichnungen schutzfähig ist. Die Entscheidung bietet eine instruktive dogmatische Klärung zu Voraussetzungen und Reichweite des Titelschutzes bei Softwareprodukten.
Werktitelverletzung bei Computerspielen weiterlesenSchutzumfang von Webseitenprogrammierungen bei Werbeblockern
Der Bundesgerichtshof hat in der Entscheidung „Werbeblocker IV“ (I ZR 131/23) die urheberrechtlichen Implikationen von Werbeblocker-Software weiter präzisiert. Im Zentrum steht die Frage, ob ein Werbeblocker, der in die Darstellung von Webseiten eingreift, eine unzulässige Umarbeitung oder Vervielfältigung eines geschützten Computerprogramms im Sinne des § 69c Nr. 1 und 2 UrhG darstellt.
Der BGH kritisiert die Vorinstanz für eine unzureichende Klärung des Schutzgegenstands und verweist die Sache zurück. Die Entscheidung enthält wichtige Hinweise zur Abgrenzung zwischen zulässiger Beeinflussung des Programmablaufs und Eingriffen in die geschützte Substanz eines Programms.
Schutzumfang von Webseitenprogrammierungen bei Werbeblockern weiterlesenKeine Unterlassungsansprüche eines Systemhauses bei nur behaupteten Software-Nutzungsrechten
Präzisierung der Aktivlegitimation nach § 97 Abs. 1 UrhG: Die dogmatischen Grundlagen der urheberrechtlichen Anspruchsberechtigung bei Softwareprojekten in arbeitsteilig strukturierten militärischen Beschaffungsvorhaben werfen nicht schnell schwierige Abgrenzungsfragen zwischen Urheber, ausschließlichem Nutzungsrechtsinhaber und schlichter Nutzungsberechtigter auf, wie das OLG Hamburg zeigt.
Mit Urteil vom 16. Januar 2025 (5 U 93/23) hat das Hanseatische Oberlandesgericht Hamburg dieses anspruchsvolle Thema anlässlich einer Auseinandersetzung um eine Kommunikations-Management-Software für F125-Fregatten ausführlich durchdrungen – und die Reichweite der Aktivlegitimation für Unterlassungsansprüche nach § 97 Abs. 1 UrhG im Kontext einfacher Nutzungsrechte dezidiert herausgearbeitet. Die Entscheidung verdient über den Einzelfall hinaus Beachtung, da sie zentrale Grundsätze zur Zuweisung von Verwertungspositionen bei werkvertraglicher Softwareentwicklung bestätigt und zugleich Klarheit über die Reichweite des § 31 Abs. 5 UrhG („Übertragungszwecklehre“) schafft.
Keine Unterlassungsansprüche eines Systemhauses bei nur behaupteten Software-Nutzungsrechten weiterlesenKein WLAN: Anfechtung von Softwareüberlassungsvertrag wegen Irrtums
Digitale Vertragsbeziehungen, insbesondere im Bereich der Softwareüberlassung, zeichnen sich durch Komplexität, Standardisierung und hohe Informationsasymmetrie aus. Der Nutzer verlässt sich auf die technische Funktionalität, während der Anbieter seine Leistung präzise umrissen wissen will.
Kommt es zu Missverständnissen über technische Voraussetzungen, stellt sich schnell die Frage, ob das Rechtsgeschäft Bestand hat – oder ob ein Irrtum vorliegt, der zur Anfechtung berechtigt. Zwei Entscheidungen – das Urteil des LG Kleve (1 O 166/22) und der Hinweisbeschluss des OLG Düsseldorf (10 U 70/23) – zeigen eindrucksvoll, wie diese dogmatischen Fragen in der rechtlichen Praxis konkretisiert werden.
Kein WLAN: Anfechtung von Softwareüberlassungsvertrag wegen Irrtums weiterlesenEUGH zum Erfüllungsort im Softwarerecht: Zuständigkeitsfragen und europarechtliche Konsequenzen
Die Bestimmung des Erfüllungsorts spielt eine zentrale Rolle bei der Frage, welches Gericht für einen grenzüberschreitenden Vertrag zuständig ist. Gerade im Bereich des Softwarerechts, wo digitale Dienstleistungen oftmals länderübergreifend erbracht werden, führt die gerichtliche Zuständigkeit regelmäßig zu Streitigkeiten.
Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seiner Entscheidung vom 28. November 2024 in der Rechtssache C-526/23 (VariusSystems digital solutions GmbH gegen GR, Inhaberin des Unternehmens B & G) diese Problematik aufgegriffen und zur Auslegung von Art. 7 Nr. 1 Buchst. b der Brüssel-Ia-Verordnung (Verordnung (EU) Nr. 1215/2012) Stellung genommen.
EUGH zum Erfüllungsort im Softwarerecht: Zuständigkeitsfragen und europarechtliche Konsequenzen weiterlesenSoftwareprojekte zwischen Werk- und Dienstvertrag
In einem Urteil des Oberlandesgerichts Frankfurt (Az.: 10 U 201/22) vom 19. Dezember 2024 ging es um einen zentralen Konflikt bei IT-Dienstleistungen: die Abgrenzung zwischen einem Werk- und einem Dienstvertrag. Dabei ging es um die Entwicklung von Schnittstellen innerhalb eines größeren Softwareprojekts und die Frage, ob der Anbieter für einen konkreten Erfolg oder lediglich für ein sorgfältiges Tätigwerden haftet. Diese Entscheidung ist für Unternehmen von erheblicher Relevanz, da sie Leitlinien für die Vertragsgestaltung und die rechtliche Absicherung bei Softwareprojekten liefert.
Softwareprojekte zwischen Werk- und Dienstvertrag weiterlesenUrheberrechtliche Relevanz der Aufnahme eines Fotos in einen KI-Trainingsdatensatz
Ein aktuelles Urteil des Landgerichts Hamburg (LG Hamburg, Urteil vom 27.09.2024 – 310 O 227/23) beschäftigt sich mit einer urheberrechtlichen Streitigkeit im Kontext der Nutzung eines Bildes in einem für das Training von Künstlicher Intelligenz (KI) erstellten Datensatz.
Es gilt: Die Aufnahme eines urheberrechtlich geschützten Fotos in einen Trainingsdatensatz für KI-Systeme stellt eine Vervielfältigung dar und benötigt daher grundsätzlich die Zustimmung des Urhebers
Urheberrechtliche Relevanz der Aufnahme eines Fotos in einen KI-Trainingsdatensatz weiterlesen